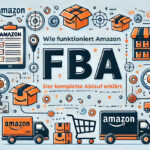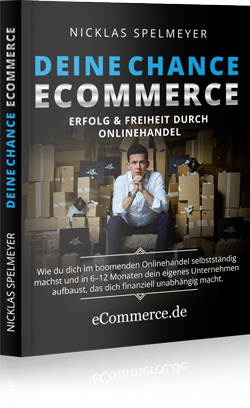Über 800 Milliarden US-Dollar beträgt der aktuelle Wert des Online-Riesen Amazon. Die Geschichte des Unternehmens ist eine steile Bergfahrt – ins Tal ging es dabei eher selten. Ein wichtiger Baustein in der heutigen Geschäftswelt von Amazon ist Amazon FBA. Mit diesem Programm schafft Amazon es auch unerfahrenen Online-Händlern den Einstieg in die Welt des E-Commerce zu ermöglichen.
103 Milliarden Euro wurden im Jahr 2022 in Deutschland im Internet umgesetzt. Die Tendenz steigt weiter. Experten erwarten bis ins Jahr 2027 eine Steigerung auf gut 180 Milliarden Euro. Das wäre eine Wachstumsrate von 11 Prozent im Jahr – ein Wachstum, das keine andere Branche vorweisen kann. Der Marktanteil von Amazon liegt dabei deutlich über 50 %. Übrigens – wiederum mehr als 50 Prozent des Umsatzes bei Amazon entfällt auf Amazon FBA Händler.
Wir zeigen dir im folgenden Artikel, warum Amazon FBA die perfekte Lösung für viele ist, die sich selbstständig machen wollen. Dafür erklären wir dir:
- Was Amazon FBA eigentlich ist.
- Für wen das die beste Lösung ist.
- Wie wir selbst mit Amazon FBA ein Millionen-Unternehmen aufgebaut haben.
- Wie die Zukunftsaussichten für Amazon FBA aktuell aussehen.
- Und was du brauchst, um dein eigenes Amazon FBA Business aufzubauen.
Was steckt hinter dem Fulfillment by Amazon?
Die Abkürzung FBA steht für „Fullfilment by Amazon“. Hier ist der Name absolut Programm. Denn bei diesem Programm übernimmt Amazon einen großen Teilder eigentlichen Aufgaben eines Online-Händlers für dich. Amazon übernimmt:
- Die Lagerung deiner Waren
- Den Versand deiner Produkte
- Die Abwicklung des Bezahlvorgangs
- Bei Bedarf auch die Erledigung der Retouren
Selbst der Kundenservice ist hier im Angebot enthalten. Das macht deine Arbeit als Online-Händler um ein Vielfaches leichter. Du musst eigentlich nur noch für die passenden Produkte sorgen und dem Kunden nach getätigtem Kauf eine Rechnung schicken. Letztlich kann sich hier jeder selbstständig machen, einen Verkäuferaccount erstellen und Produkte im Internet verkaufen.
Wie genau funktioniert das Konzept von Amazon FBA?
Das klingt wunderbar einfach? Ist es im Endeffekt aber doch nicht. Zumindest nicht ganz so einfach, wie man auf den ersten Blick meinen mag. Denn du musst dich noch immer um zwei Dinge kümmern, die sehr wichtig sind, damit du überhaupt Erfolg haben kannst. Du musst das passende Produkt auswählen und es dann auch gut vermarkten.
Amazon FBA funktioniert im Prinzip in mehreren Schritten. Damit du selbst als erfolgreicher Amazon FBA Händler auftreten kannst, musst du:
- Ein Gewerbe anmelden
- Ein Geschäftskonto einrichten
- Eine Steuernummer beantragen und damit deinen Amazon Verkäuferaccount einrichten
- Deine Produktidee finden, mit der du an den Markt gehen willst
- Einen Hersteller oder Großhändler finden, der dein Produkt genau so besorgen oder herstellen kann, wie du es haben möchtest.
- Dann musst du die Produkte bestellen und direkt an Amazon schicken lassen. Dort werden deine Produkte dann eingelagert.
- Als Nächstes musst du die Produktseite auf Amazon erstellen – diese muss Kunden anlocken und zum Kauf überzeugen.
- Wenn das alles steht, musst du dein Produkt nur noch verkaufen – alles Weitere erledigt Amazon für dich
Benötige ich für Amazon FBA ein Warenlager?
Die Idee hinter Amazon FBA ist die, dass Amazon deine Produkte für dich lagert und den Versand erledigt. Als Amazon FBA Händler bekommst du nach abgeschlossener Produktauswahl deine eigenen Produkte nicht mehr in der Hand. Das macht es so leicht auch ohne großen Raumaufwand aus der eigenen Wohnung heraus mit einem Amazon FBA Business zu starten.
Welche Vorteile hat Amazon FBA?
Die Vorteile von Amazon FBA als Grundlage für dein Business sind vielfältig.
- Du hast über den Amazon Marktplatz Zugang zu Millionen potenzieller Kunden und musst dafür keinen eigenen Online-Shop aufbauen und erst bekannt machen.
- Die Kunden vertrauen dir vom ersten Tag an – du hast als Amazon FBA Händler das Amazon Prime Banner und auch in Sachen Zahlungsmöglichkeiten erledigt Amazon alles für dich. Es stellt sich für einen Neukunden also nicht die Frage, ob er dir soweit vertraut, dass er seine Bank- oder Kreditkartendaten bei dir im Online-Shop hinterlegt.
- Hier sind alle Geschäftsprozesse voll automatisiert. Du selbst kannst dich auf die Entwicklung deiner Produktideen konzentrieren und auf die bestmögliche Präsentation deiner Waren.
- Ein Amazon FBA Business kannst du von überall auf der Welt aus betreiben. Ob aus einer Studentenbude, einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder von einer Weltreise aus. Ob als Mutter von drei Kindern, die sich mit der Selbstständigkeit den Traum von Familie und Beruf in Kombination verwirklichen will oder als Single mit dem Wunsch durch eine nebenberufliche Selbstständigkeit mehr finanzielle Sicherheit zu erlangen.
- Du hast 24/7 geöffnet – auch wenn du mal ein paar Tage nicht arbeitest oder im Urlaub bist.
Amazon FBA ist nicht so banal, wie viele denken
Das klingt fast so, als würde das Geld hier auf der Straße liegen. Das tut es aber leider nicht. Denn auch wenn Amazon FBA ein hervorragendes Geschäftsmodell ist, gibt es jedes Jahr aufs Neue eine Menge Menschen, die sich damit selbstständig machen und keinen Erfolg haben. Denn es gibt heute bereits mehrere Tausend Amazon FBA Händler in Deutschland und die Tendenz ist steigend. Mehrere Hunderttausend Produkte werden täglich über den Amazon Online-Shop verkauft.
Damit du ein Stück von diesem Kuchen abbekommen kannst, ist es wichtig, die Sache richtig anzugehen. Das fängt schon mit der Auswahl des richtigen Produktes an. Denn viele sogenannte Experten in diesem Bereich empfehlen dir, dir eine Nische zu suchen, in der es noch keine große Konkurrenz gibt. Das Problem dabei: Solche Nischen gibt es heute meist nur noch mit Produkten, mit denen sich auch kein großer Absatz machen lässt.
Du solltest dich vielmehr für Produkte interessieren, die bereits gut bei Amazon laufen und die du weiter optimieren kannst.
Ein gutes Hilfsmittel können dabei negative Bewertungen zu einzelnen Produkten sein. Hast du ein solches Produkt gefunden, wird der nächste Schritt nicht leichter. Denn jetzt heißt es, einen Hersteller oder Großhändler zu finden. Dieser muss dein Produkt genau so produzieren oder anbieten, wie du es dir vorstellst. Eben mit den notwendigen Verbesserungen, um dich von der Konkurrenz abzuheben.
Jetzt heißt es Muster vergleichen und den passenden Anbieter aussuchen. Dann geht es in die Preisverhandlungen und erst danach kannst du deine Waren bestellen und in das Amazon Warenlager schicken lassen. Dann folgt der dritte schwierige Schritt: die Präsentation und Vermarktung deiner Produkte.
Die folgenden Faktoren stellen für viele Neulinge auf dem Gebiet des Amazon FBA eine große Hürde dar:
- Die richtige Produktauswahl.
- Die Auswahl und die Verhandlungen mit dem richtigen Lieferanten.
- Die richtige Präsentation und Vermarktung der auf den Markt gebrachten Produkte.
Wir bieten dir ein passendes Coaching an, in dem wir dich genau da abholen, wo du gerade stehst und die auf dem Weg hin zu deinen ersten erfolgreichen Produkten begleiten. Dabei wissen wir ganz genau, was wir tun und wie auch du dauerhaft Erfolg mit Amazon FBA haben kannst. Denn wir haben selbst vor etwas mehr als 5 Jahren unser Geschäft aus dem Nichts aufgebaut.
Ich habe damals nach einer Möglichkeit gesucht, in einer Selbstständigkeit möglichst sicher und kalkulierbar ein gewisses Einkommen zu erzielen. Das gestaltete sich anfangs schwieriger als gedacht, weshalb ich mit einigen anderen Geschäftsmodellen Versuche gestartet, aber dann auch wieder eingestellt habe. Ich selbst habe damals bei Mercedes gearbeitet und wollte etwas zusätzliche Sicherheit gewinnen und auf lange Sicht mein eigener Chef sein. Schon nach 1,5 Jahren im Amazon FBA Business hatte ich meine ersten 100.000 Euro Umsatz eingefahren.
Heute haben meine Produkte bereits mehrere Millionen Euro Umsatz gemacht. Auch wenn nicht jedes meiner Produkte im Laufe der Jahre sofort gezündet hat, gab es doch nie ein Produkt, das unter dem Strich mehr als einige Hundert Euro Verlust verursacht hätte. Im Gegenzug bringen die Produkte, die wirklich am Markt funktionieren, einige tausend Euro Gewinn ein – teilweise sogar in einem Monat.
Mit dem richtigen Coach an deiner Seite kannst auch du diesen Erfolgsweg gehen. Ohne einen entsprechenden Mentor und die notwendigen Hilfestellungen kann dieser Weg allerdings schnell steinig werden. Denn gerade, wenn du dich auf die gängigen Meinungen in Ratgeber-Videos und Artikeln zum Thema Amazon FBA verlässt, findest du dich oft schnell auf dem falschen Weg wieder und kannst am Ende dein Ziel, ein erfolgreiches und einträgliches Business aufzubauen, gar nicht erreichen.
Für wen ist Amazon FBA geeignet?
Amazon FBA ist für jeden geeignet, der etwas Startkapital hat und damit in die Selbstständigkeit starten möchte. Ob als zweites Standbein in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit oder als Hauptjob, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen – wichtig ist, dass gerade am Anfang noch zusätzliches Einkommen da ist. Denn du wirst nicht direkt in den ersten Monaten von deinen Einnahmen leben können. Außerdem brauchst du für einen wirklich erfolgreichen Start in dein Amazon FBA Business Startkapital. Das heißt, du solltest dir den Start in diese Form der Selbstständigkeit auch leisten können.
Amazon FBA Erfahrungen – 20.000€ Gewinn pro Monat und mehr
Ich habe dir gerade meine eigene Geschichte erzählt. Doch das ist bei Weitem kein Einzelfall. Mehr als 700 Menschen haben wir bereits dabei geholfen, als Amazon FBA Seller ein erfolgreiches Business aufzubauen. Welche unserer Kunden hatten vorher überhaupt keine Erfahrung mit einer Selbstständigkeit und schon gar nicht auf dem E-Commerce-Sektor.
Die folgenden Videos zeigen dir einige dieser Erfolgsgeschichten und machen deutlich: Wenn ich selbst und unsere Kunden das in den letzten Jahren geschafft haben, kannst du deine Ziele auch erreichen. Mit harter Arbeit und dem richtigen Coaching ist auf dem riesigen E-Commerce-Markt sehr viel möglich.
Ist Amazon FBA auch noch in einigen Jahren ein Erfolgskonzept?
Diese Frage stellt man sich natürlich, bevor man sich an ein derart großes Projekt wie eine Selbstständigkeit im Online-Handel heranwagt. Die Antwort ist vielversprechend. Du kannst davon ausgehen, dass der Erfolg von Amazon FBA im Allgemeinen in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird.
Denn wie wir weiter oben schon gesehen haben, erwarten Experten eine weitere Steigerung der Umsatzzahlen im E-Commerce in den nächsten vier bis fünf Jahren. Parallel dazu baut Amazon seine Marktdominanz in Deutschland immer weiter aus und gewinnt immer mehr Marktanteile.
Das wiederum führt dazu, dass ein immer größeres Stück des riesigen Kuchens bei Amazon-Händlern hängen bleibt. Ein weiterer positiver Faktor ist die Ankündigung des Online-Riesen, dass man bei Amazon in den nächsten Jahren die Produktion und Entwicklung von Eigenmarken und eigenen Produkten wieder etwas reduzieren möchte. Damit bietet Amazon seinen FBA-Händlern in allen Sparten wieder etwas mehr Raum für den eigenen Erfolg.
Welche Möglichkeiten bietet Amazon FBA in der Zukunft?
Amazon arbeitet an einigen spannenden Features für die Zukunft. So zum Beispiel an einer App, die von der Bedienung her stark an die social media Plattform TikTok erinnert. Hier können Kunden durch die aktuellen Produkte scrollen und sollen so ein ganz neues Shopping-Erlebnis genießen. Erhältlich ist dieses Feature bislang nur in den USA. Doch auch für den deutschen Markt ist eine entsprechende Entwicklung zu erwarten.
Was benötigst du für Voraussetzungen für den Start?
Du musst die rechtliche Grundlage für deine Selbstständigkeit legen. Das geht, indem du:
- ein Gewerbe anmeldest,
- ein Geschäftskonto einrichtest und
- eine Steuernummer beantragst.
Damit kannst du dann einen Amazon Verkäuferaccount eröffnen. Mit dem kann es dann so richtig losgehen. Jetzt brauchst du nur noch das passende Produkt und ausreichend Startkapital, um einen Grundstock an Waren einzukaufen.
Zusammenfassung und Fazit: Großes Potenzial mit kleinem Startkapital
Die Möglichkeiten als Amazon FBA Händler sind riesig. Mit diesem Geschäftsmodell machen sich jedes Jahr mehrere Hundert Menschen in Deutschland erfolgreich selbstständig. Denn die Plattform ist riesig, der möglichen Umsätze sind enorm und entsprechend groß sind auch die Chancen. Dafür musst du als Erstes ein Produkt finden, dass bereits einen guten Absatz hat. Dieses sollte einige Macken haben, die du mit einem neuen Produkt verbessern kannst. So kannst du dich von der Konkurrenz abheben.
Then it’s time to find a manufacturer who will produce the product exactly according to your wishes. It is important that you only buy your goods yourself for a few dollars and in the end can create the largest possible profit margin. When the product has been delivered to Amazon, you create your product page. Here it always makes sense to hire professionals to design the product photos and possible product videos . Because without a good product text, appealing images and a good video, you will have a hard time, especially in competitive market areas.
92 percent of all people who want to make money online fail with their ideas. So that this does not happen to you, it is important to prepare yourself for the difficulties in e-commerce with good coaching and a mentoring program . We would be happy to assist you with a free consultation at this point. You can throw the door wide open today – to extraordinary business success in the world of Amazon FBA.
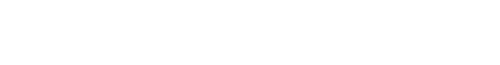
 Grundlagen
Grundlagen